Ich sitze im Krankhaus-Flur auf einem Bänkchen. Die Zimmernachbarin meiner Frau wird gerade untersucht und zur Wahrung ihrer – und meiner – Privatsphäre wurde ich rausgeschickt. Während ich so vor mich hinwarte, öffnet sich plötzlich die Tür des Nachbarzimmers. Ein grimmiger Pirat mit schwarzem Hut und finsterem Blick knurrt mich an und zielt mit einer Pistole auf mich. Was der Situation ein wenig die Bedrohlichkeit nimmt, ist der Umstand, dass der Pirat nur circa einen Meter groß und blond gelockt ist, und es sich bei seiner Pistole um eine leere Klopapierrolle handelt. Außerdem trägt er einen Schlafanzug mit Elefanten.
Wie es sich für einen Erwachsenen gehört, der von einem Mini-Piraten bedroht wird, erschrecke ich mich vorschriftsmäßig und hebe die Arme. Der Kleine feuert trotzdem mit lautem „Peng“ seine Klorollen-Pistole ab. Erneut vorschriftsmäßig fasse ich mir mit beiden Händen an die Brust, stöhne oscar-reif auf und sacke GZSZ-reif tot zusammen. Der kleine Pirat kichert und verschwindet in seinem Zimmer.
Vielleicht wundern Sie sich, was ein Mini-Pirat im Schlafanzug hier zu suchen hat. Die Erklärung ist ganz einfach: Er ist hier Patient. Wegen ihres angeborenen Herzfehlers liegt meine Frau auch als Erwachsene immer auf der kardiologischen Kinderstation. Kinderkardiologen sind auf angeborene Herzfehler spezialisiert, egal wie alt die Patienten sind. Die normalen Kardiologen sind es dagegen eher gewohnt, dass sich ihre Patienten die Herzen durch ungesundes Essen, Alkohol und Stress zugrunde richten.
Auf einer Kinderstation zu liegen, hat auch als Erwachsener viele Vorteile. An den Wänden hängen lustige Bilder vom Tiger und dem kleinen Bären, in den Untersuchungszimmern sitzen Puppen und Kuscheltiere und auf dem Gang wird gemalt, gebastelt oder Fußball gespielt. Aber das Allerbeste: Nach einer Untersuchung bekommst du eine Quietscheente geschenkt. Auch mit 44!
Meine Frau muss zu einer Reihe von Voruntersuchungen. Das hört sich einfacher an, als es ist. Die Uniklinik ist riesig, die Gänge sind sehr verwinkelt und die Ausschilderungen so kryptisch, dass Dechiffrier-Experten des Mossad an der Entschlüsselung scheitern würden. Außerdem haben meine Frau und ich den Orientierungssinn einer Schrankwand. Und zwar einer Schrankwand mit acht Bier, sechs Prosecco, fünf Kurzen und drei Mojitos intus, die sich mit verbundenen Augen 28-mal um die eigene Achse gedreht hat.
Eine freundliche Stationsschwester erklärt uns den Weg: „Gehen Sie einfach durch die Tür, wo der Essenswagen steht, dann links durch zwei weitere Türen, danach rechts, da immer weiter an der Leistelle B1 vorbei, anschließend kommt die Leitstelle B2, da müssen Sie auch nicht hin, sondern weiter geradeaus, vorbei am Gleichstellungsbüro, rechts kommt das Sozialbüro, da biegen sie links ab und dann sind sie bei der kinderkardiologischen Ambulanz.“ Ich nicke wissend, habe aber schon nach „Tür, wo der Essenswagen steht“ nur noch „blabli blablö, B1, blablu blabla B2, blublo, bluble Sozialbüro, pallim pallim“ verstanden.
Nach kurzem Fußmarsch und erstaunlicherweise ohne uns hoffnungslos zu verlaufen und 30 Jahre später als BILD-Schlagzeile „Gruselfund im Klinik-Keller: Wer sind die beiden Mumien?“ zu enden, erreichen wir die kinderkardiologische Ambulanz. Eine Frau, deren Stimmungsbarometer ein langanhaltendes Tiefdruckgebiet mit starkem Niederschlag und gelegentlichen Gewittern anzeigt, nimmt die Unterlagen entgegen. Anscheinend ist ihr nicht nur eine Laus, sondern eine stepptanzende Elefantenherde über die Leber gelaufen. Ihr mürrisch-motziger Tonfall wirkt im Umgang mit den Patienten ein wenig befremdlich, bei uns weckt es ein heimeliges Berlin-Gefühl.
Beim Ultraschall zeichnet ein junger Arzt am Monitor eifrig Linien nach. Ich erkenne genauso wenig wie damals bei den Schwangerschaftsuntersuchungen. Ich verkneife mir die Frage, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
Anschließend klärt uns der Anästhesist über die morgige Narkose auf. Er fragt meine Frau, ob sie etwas über die Risiken und Nebenwirkungen wissen möchte. Sie verneint. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Sie kann ja schlecht sagen: „Das ist mir zu krass. Geben sie mir lieber ein Beißholz und eine Flasche Rum.“
Wir sitzen im Untersuchungszimmer der Kinderstation. Von der Wand lachen uns Ernie und Bert an, was die Stimmung ein wenig auflockert. Zumindest bei uns. Der Nachwuchs-Doc von eben ist nicht ganz so locker. Er versucht verzweifelt, eine geeignete Vene bei meiner Frau zu finden, um ihr Blut abzunehmen. Ihre Adern sind aber sehr dünn und auf der Haut kaum zu sehen. Selbst nachdem der PJler den Stauschlauch an ihrem Oberarm mehrmals fester gezogen hat, werden sie nicht dicker.
Glücklicherweise ist das Selbstvertrauen des Junior-Arztes gering genug und er sticht nicht auf gut Glück in ihren Armen rum. Er holt eine Assistenzärztin zur Hilfe. Unnötig zu erwähnen, dass sie altersmäßig meine jüngere Schwester sein könnte. Also, wenn meine Eltern fünfzehn Jahre nach mir nochmal Nachwuchs bekommen hätten.
Sie hat zwei Medizinstudentinnen im Schlepptau, die – was ich nicht für möglich gehalten hätte – noch jünger aussehen als der PJler. Vielleicht ist heute aber auch Girls-Day und es sind zwei Schülerinnen, die mal auf Station reinschnuppern. Ernie und Bert begrüßen die beiden fröhlich. Ist ja altersmäßig fast ihre Zielgruppe.
Die Assistenzärztin quält sich ebenfalls mit den Adern meiner Frau herum. Minutenlang sucht sie Arme und Hände ab, klopft auf ihnen herum, versetzt den Stauschlauch mehrmals, aber die Adern bleiben dünn wie Nylonfäden. Meine eigenen Adern sind dagegen sehr kräftig. Fast schon krankhaft dick wie Schiffstaue verlaufen sie auf meinen Unterarmen. Ich biete der Ärztin an, sie könne bei mir Blut abnehmen. Ernie und Bert schauen nicht mehr ganz so fröhlich, sondern gelangweilt.
Nach einer Weile gibt die Ärztin entnervt auf und holt eine weitere Kollegin. Diese ist erfreulicherweise nur zehn Jahre jünger als wir. Auch sie tut sich mit den Venenfädchen meiner Frau schwer. Nach ein paar Minuten Suchen sticht sie zu – wahrscheinlich mit geschlossenen Augen – und trifft tatsächlich eine Vene. Ernie und Bert brechen in spontanen Jubel aus.
Alle Folgen des Krankenhaus-Blogs:
- Tag 1: Ein kaputtes Herz muss man reparieren
- Tag 2: Don’t go breaking her heart
- Tag 3: Her heart will go on
- Tag 4: Every beat of her heart


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
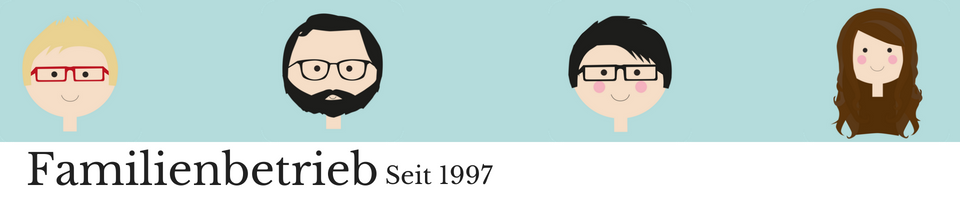
Ich hoffe, deine Frau hat den Eingriff gut überstanden und ist auf dem Wege der Besserung. Ich wünsche Euch ein schönes Weihnachtsfest.
Herzliche Grüße
Birgit
Sorry, aber ich kringel mich vor Lachen, es ist einfach zu geil geschrieben. :-)