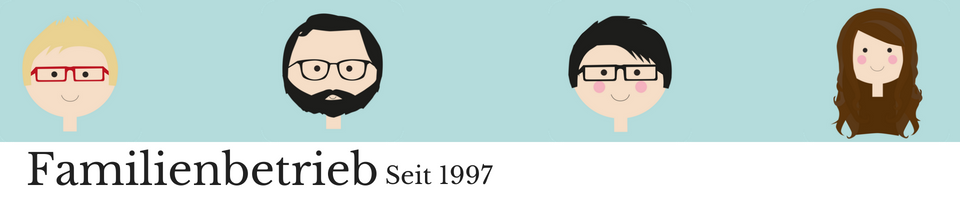Nach der Nachtzugfahrt, die in ihrer Beschwerlichkeit als Vorlage für einen Jules-Vernesschen-Reiseroman dienen könnte und wenig Anlass bietet, in späteren Jahren mit dem rosaroten Blick der Verklärung darauf zu schauen, kommen wir wenigstens pünktlich um 7 Uhr morgens in Paris an.
Machen uns mit dem gesamten Urlaubsgepäck auf dem Rücken bzw. unter den Armen zu Fuß auf den Weg zur Herberge, was darauf zurückzuführen ist, dass unsere Französischkenntnisse nicht dazu ausreichen, ein Taxi zu bestellen. Schlagen dabei überraschenderweise direkt den richtigen Weg ein, was angesichts unserer ausgeprägten Orientierungslegasthenie als größte Sensation seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus gelten kann. Wird allerdings von den Kindern, deren Laune sich proportional zur zurückgelegten Wegstrecke verschlechtert, mit wenig Anerkennung quittiert.
Bekommen bei der Ankunft im vor Wochen gebuchten Hostel eröffnet, dass unsere reservierten Zimmer nicht zur Verfügung stünden, wir aber in eine bessere Unterkunft umquartiert worden seien. Während der zusätzliche Fußmarsch nicht gerade zu enthusiastischen Begeisterungsstürmen der Kinder führt, werden wir in der neuen Herberge durch eine Jugendgefängnisästhetik der Zimmereinrichtung entschädigt, die mit einer großen Menge Euphemismus als spartanisch-reduziert bezeichnet werden kann. Inspiziere das Badezimmer und beschließe, dieses nur noch ohne Brille zu betreten.
Suchen danach ein nahegelegenes Café auf und trinken zwei Cappuccini, einen Eistee und eine Apfelschorle im Wert eines 3-Gänge-Menüs. Nachdem die ankommenden Bonner Freunde mit großem Hallo begrüßt wurden, unterstütze ich ihre Suche nach einem Parkhaus.
Versuche das Auto als Co-Pilot durch das Pariser Einbahnstraßenlabyrinth zu lotsen und bin dabei so hilfreich wie ein Blinder, der einen Stadtplan liest. Finden nach mehreren Extraschleifen schließlich ein dubioses Parkhaus und geben das Auto mitsamt Schlüssel ab. Hoffen, es handelt sich tatsächlich um einen Parkwächter und nicht doch um einen Gebrauchtwagenhändler, der uns am Samstag 2.000 Euro in die Hand drückt und mit den Worten verabschiedet, mehr habe die Karre halt nicht gebracht.
Erweisen uns dann bei der Suche nach einer gastronomischen Lokalität zwecks Einnahme des Abendessens als wenig frankophil, da wir bereits um 18.30 Uhr speisen wollten, um das Eskalationspotenzial durch hungrige quengelnde Kinder zu minimieren. Werden schließlich bei einem kleinen Bistro fündig, wo der Gastwirt versichert, der Koch müsse eigentlich jeden Augenblick an seinem Arbeitsplatz erscheinen, was dieser um 20 Uhr auch tatsächlich tut.
Mache abends im Hostel die Erfahrung, dass man der Einzige am Tisch ist, der sich beim Wurf zweier Kniffel hintereinander freut.

Ausblick aus Hostel – Haus

Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)