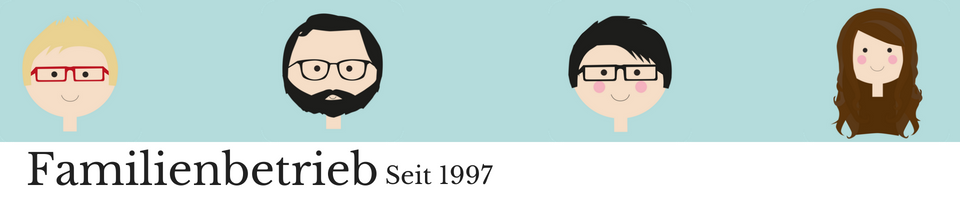Im Zug fällt mir ein, dass ich mich nicht von dem Kioskbesitzer verabschiedet habe und fühle mich ein wenig schlecht. Er ist mir doch ans Herz gewachsen. Außerdem hat er mich in der ganzen Woche zuverlässig mit Nahrung versorgt, so dass ich keinen Hunger und Durst leiden musste. (Tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so etwas wie ein Hungergefühl hatte.)
Auf der weiteren Fahrt lasse ich die letzten Tage Revue passieren. Fast eine Woche bestand meine Welt aus Krankenhaus, Hotel und dem Weg zwischen Hotel und Krankenhaus. Tagsüber war ich Neben-dem-Bett-Sitzer, Flaschen-Anreicher, Essenstablett-Holer-und-Wegbringer, Nierenschalen-Halter, Kissen-Aufschüttler, Decken-Glatt-Streichler und Händchen-Halter. Nachmittags war ich der Im-Lichthof-Rumsitzer, der Durch-die-Krankenhausgänge-Herumirrer, der Kioskumsatzantreiber, der Das-Geschehen-Beobachter und der Automaten-Käsekuchen-Esser. Abends wiederum war ich eine Mischung aus Pressesprecher und Propagandaminister, der Telefonate führt und Textnachrichten verschickte, um die Familie, Freunde und Bekannte mit den neuesten medizinischen Informationen und Genesungsfortschritten zu versorgen.
In dieser Zeit habe ich keine Nachrichten verfolgt, kein Fernsehen geschaut, keine Zeitung gelesen und die sozialen Medien weitestgehend gemieden. Mein Kontakt zur Außenwelt bestand in den Telefonaten mit den Kindern, der Schwiegermutter und meinen Eltern sowie dem Austausch in der WhatsApp-Gruppe mit der krummbuckligen Sippe. Ich habe keine Ahnung, was in den letzten sechs Tagen in der Welt alles passiert ist. Robert Habeck könnte Bundeskanzler und Donald Trump impeached sein, ich wüsste nichts davon.
Ich habe quasi wie in einer Blase gelebt, in einer mir etwas fremden Welt. Ein bisschen wie in „Lost in Translation“. Nur dass ich nicht im Bademantel rumgelaufen bin. Glaube ich zumindest. Und mit den immergleichen Ritualen und Abläufen war es auch ein bisschen wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Nur dass mir im Krankenhaus bedauerlicherweise kein Murmeltier begegnet ist. Glaube ich zumindest.
Kurz nach halb Sieben schließe ich die Wohnungstür auf. Die Kinder kommen aus ihren Zimmern gelaufen und freuen sich, dass ich wieder da bin. Nach ausgiebiger Begrüßung und Gruppenumarmung inspiziere ich unauffällig die Wohnung. Ich will ja nicht wie ein spießiger Kontrolletti rüberkommen. Alles in allem sieht es einigermaßen ordentlich aus. Also, nicht perfekt, aber auch nicht schlimmer als sonst am Wochenende, bevor wir Großputz machen. (Womöglich sind es gar nicht die Kinder, die für den Schmutz und die Unordnung in unserer Wohnung verantwortlich sind?)
Der Kühlschrank ist fast noch genauso voll wie vor unserer Abreise. Dafür zeugen einige leere Cornflakes-Packungen im Papiermüll, was das Hauptnahrungsmittel der Kinder in den letzten Tagen war. (Die einen ernähren sich halt von Cornflakes, die anderen von Sandwiches und Automaten-Käsekuchen.)
Im Badezimmer hängt frisch gewaschene Wäsche auf dem Ständer. Sogar die Wäscheklammern sind farblich sortiert. Ich schicke meiner Frau ein Foto davon, um ihren inneren Monk zu erfreuen und als Beleg, dass wir bei der Erziehung nicht vollkommen versagt haben.
Es ist ein gutes Gefühl, dass die Kinder so vernünftig sind und die Wohnung nicht in ein „Fear and Loathing in Las Vegas“-Hotelzimmer verwandeln, wenn wir sie mal ein paar Tage alleine lassen. Vielleicht können wir das demnächst mal wiederholen. Dann aber lieber nicht für einen Krankenhausaufenthalt, sondern für einen Kurzurlaub.
Nachdem ich meinen Rucksack ausgeräumt habe, gehen wir gemeinsam essen und feiern uns ein bisschen, dass wir die Woche so bravourös gemeistert haben. Meine Frau, die stolz auf ihren Körper sein kann, der die Strapazen der OP so gut weggesteckt hat, die Kinder, die daran gewachsen sind, sich ein paar Tage selbst zu versorgen, und ich, der ich es geschafft habe, mein Lebendgewicht in Form von Sandwiches, belegten Brötchen, Schokoriegeln und Automatenkäsekuchen zu mir zu nehmen.
Abends im Bett kann ich nicht einschlafen. Meine gewohnte Umgebung ist mir ungewohnt geworden. Es fühlt sich fast ein wenig fremd an, wieder Zuhause zu sein und im eigenen Schlafzimmer zu liegen.
Schließlich schlafe ich doch ein. Im Traum sitze ich mit einem Bademantel bekleidet auf einer Bank im Krankenhaus-Lichthof. In meinem Schoß liegt ein Murmeltier, dem ich zärtlich den Kopf kraule, während ich das geschäftige Treiben beobachte. Der Kiosk-Besitzer kommt aus seinem Laden, setzt sich zu mir und legt seinen Arm um mich. Dann reicht er mir einen Automaten-Käsekuchen und sagt: „Alles ist gut.“
The End.
Die Operation meiner Frau ist schon einige Wochen her und sie hat sich prächtig erholt. Ich verneige mich in demütiger Dankbarkeit vor dem Professor und dem Operationsteam sowie den Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegepersonal, sowohl auf der Intensiv- als auch auf der Kinderstation. Bei der ganzen Hektik und all dem Stress, die den Krankenhausbetrieb kennzeichnen, waren alle immer und ausnahmslos freundlich, umsichtig und empathisch. Sie haben alle einen großen Anteil an der schnellen Genesung meiner Frau. Vielen Dank!
Alle Folgen des Krankenhaus-Blogs:
- Tag 1: Ein kaputtes Herz muss man reparieren
- Tag 2: Don’t go breaking her heart
- Tag 3: Her heart will go on
- Tag 4: Every beat of her heart
- Tag 5: Tock! Goes her heart
- Tag 6: Heart of gold


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)