###
Abends Beginn der Olympischen Spiele in Paris. Die letzte Eröffnungsfeier, die ich mir komplett angeschaut habe, war 1984 bei den Winterspielen in Sarajevo. Damals ging ich in die vierte Klasse und musste einen Vortrag darüber halten. Ich stellte meinen Kassettenrekorder neben unseren Fernseher, nahm große Teile der Übertragung auf und spielte die qualitativ fragwürdige Aufnahme am nächsten Tag vor der Klasse ab. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wohlwollend meine Lehrerin meine Multimedia-Präsentation beurteilte.
Die Show in Paris findet erstmals nicht im Stadion statt, sondern in der ganzen Stadt verteilt. Zunächst rennt die französische Fußball-Legende Zinedine Zidane mit der olympischen Fackel durch die verstopften Straßen von Paris, hastet dann in die Metro, um dann mit der Bahn steckenzubleiben. Das macht nicht gerade Hoffnung auf einen reibungslosen ÖPNV während den Spielen.
Zidane gibt die Fackel an drei Kinder weiter. Die sie durch die Katakomben der französischen Hauptstadt, vorbei an einer gruseligen Wand, in die Totenköpfe eingemauert sind. Im Hintergrund sind Ratten zu sehen, in der Kanalisation schwimmt ein Krokodil. (Ich hoffe inständig, dass im Pariser Abwässersystem keine Krokodile leben.)
Plötzlich erscheint ein Boot mit einem mysteriösen Maskenmann, der wie eine Mischung aus Imker, Sportfechter, Phantom der Oper und Hauptfigur aus dem Computerspiel Assassin’s Creed aussieht. Die Kinder gehen trotzdem zu ihm an Bord, was bei mir die Frage aufwirft, ob ihre Eltern ihnen nicht eingebläut haben, niemals mit Fremden mitzugehen und schon gar nicht mit creepy Maskenmenschen, die in der Pariser Kanalisation rumschippern.) Wenigstens ziehen sie Schwimmwesten an. So viel Sicherheit muss sein.
Oberirdisch hüllt ein Feuerwerk eine Brücke in den französischen Nationalfarben ein, dann fahren die Teams auf Booten über die Seine. Insgesamt 85 Schiffe jedweder Größe für die mehr als 150 teilnehmenden Nationen. Das Ganze ist etwas langatmig, denn in erster Linie siehst du Menschen dabei zu, wie sie auf Booten fahren und winken. Bei vielen Ländern habe ich keine Ahnung, wo sie liegen. Zum Beispiel Bhutan, Gabun oder Trinidad und Tobago. Von denen habe ich aber zumindest schon einmal gehört. Was ich von St. Vincent und die Grenadinen, Mikronesien oder Nauru nicht behaupten kann.
Für Abwechslung sorgt ein spektakulärer Ritt durch die französische Geschichte und Kultur, bei dem ein Höhepunkt auf den nächsten folgt. Lady Gaga tanzt und singt mit pink befederten Tänzer*innen, das Moulin-Rouge-Ensemble schwingt beim Cancan die Beine in die Höhe, eine Metal-Band performt mit einer Opernsängerin und einem Chor geköpfter Marie-Antoinettes, eine franko-malische Sängerin tritt mit der Militärkapelle der republikanischen Garde auf, eine Frau singt auf einem Dach die französische Nationalhymne, artistische Street-Sport-Einlagen werden gezeigt, die Minions klauen die Mona Lisa, eine queere Modenschau ist da Vincis letztem Abendmahl nachempfunden, mit Dragqueens, Transmenschen, Behinderten und Halbnackten als Apostel, ein Hochseil-Artist besteigt ein Seil in schwindelerregender Höhe und wird dann irgendwie von der Regie vergessen und nie wieder eingeblendet, eine wilde Dance-Choreo zu einem Club-Hits-Medley der 90er und 00er Jahre beschwört die Einheit Europas, große Frauen der französischen Geschichte werden gewürdigt und schließlich interpretiert eine Sängerin auf einer im Wasser treibenden Scholle John Lennons „Imagine“, ein Mann an einem brennenden Flügel begleitet sie. Ganz großes Kino.
Zwischendurch erscheint immer wieder der Maskenmann, rennt über regennasse Dächer, läuft durch die Kulisse von „Les Miserables“, legt eine Breakdance-Einlage ein, schaut im Louvre vorbei, tanzt und schleppt die Fackel kreuz und quer durch Paris.
Eine silbrig uniformierte Gestalt reitet inzwischen mit der olympischen Flagge auf einem mechanischen Pferd über die Seine zum Trocadéro am Eiffelturm, wo immer mehr Sportler*innen eintreffen. Dort übergibt sie die Fahne an vier Vertreter der französischen Streitkräfte, die diese dann versehentlich falschrum hissen, mit den zwei Ringen nach oben, aber das kann in dem Tohuwabohu ja mal passieren.
Die Reden des Vorsitzenden des Organisationskomitees und von IOC-Präsident Thomas Bach folgen, was mir die Gelegenheit gibt, die Spülmaschine einzuräumen.
Ich bin rechtzeitig aus der Küche zurück, als der Maskenmann auftaucht und die olympische Fackel an Zidane übergibt, der es trotz stehengebliebener U-Bahn irgendwie zum Eiffelturm geschafft hat. Der Franzose humpelt über die langgezogene Bühne, auf der ihm Rafael Nadal nicht minder schwerfällig entgegenkommt. Diesen streckt er nicht mit einem Kopfstoß nieder, sondern händigt ihm die Flamme aus.
Mit der geht der spanische Tennisprofi zu einem kleinen Boot, auf dem schon der US-Leichtathlet Carl Lewis, die rumänische Kunstturnerin Nadia Comăneci sowie die Tennisspielerin Serena Williams auf ihn warten. In rasanter Fahrt schießen sie über die wellige Seine, wobei keiner der Vier den Eindruck macht, besonders viel Spaß zu haben. Insbesondere Carl Lewis sieht aus, als müsste er sich jeden Moment über die Reling erbrechen.
Am Ufer angekommen, geht die Fackel an Amelie Mauresmo – wieder eine Tennisspielerin –, die sich damit Richtung Louvre aufmacht. (Der Maskenmann fragt sich derweil, warum er eigentlich durch ganz Paris gerannt ist, wenn die scheiß Flamme jetzt wieder zurückgebracht wird.) Am Eingangsbereich des Louvre-Geländes übernimmt ein französischer Basketball-Star die Fackel. Sein Laufstil ist ähnlich unrund wie bei Zidane und Nadal, was darauf schließen lässt, dass Profi-Sport nicht besonders gesundheitsfördernd ist.
Die Flamme wird jetzt im Akkord zwischen französischen Spitzensportler*innen hin und her gereicht, die weder ich noch das Kommentatorenteam erkennen. Zwischendurch übernimmt ein älterer Mann die Fackel, der wie der Hausmeister vom Louvre aussieht und unterbinden will, dass hier mit offenem Feuer hantiert wird.
Schließlich landet die Flamme bei einem greisen Mann im Rollstuhl, einem ehemaligen Radfahrer, der mit 100 Jahren der älteste noch lebende Medaillengewinner aus Frankreich ist, und geht dann weiter an eine Leichtathletin und einen Judoka. Die entzünden damit das olympische Feuer, das überraschenderweise mit einem Heißluftballon in den Abendhimmel steigt. Ich hoffe, die Organisatoren haben sich Gedanken gemacht, wie sie das Ding in zwei Wochen wieder runterbekommen.
Zum Abschluss noch ein letztes Highlight am Eiffelturm. Auf dem steht Céline Dion auf einer Plattform, tritt das erste Mal seit vier Jahren wieder auf und singt den Edith-Piaf-Klassiker „L’Hymne à l’amour“. Gänsehaut-Moment.
Damit endet ein vogelwilder, vierstündiger Fiebertraum, bei dem die Vertreter des Ressemblement France und der katholischen Kirche wahrscheinlich schwankten, ob sie ohnmächtig oder tobsüchtig werden sollen. Man wusste bei der Eröffnungszeremonie vielleicht nicht immer, was gerade passiert und warum, aber sie lässt einen gleichermaßen begeistert und geplättet zurück. Wahrscheinlich denkt das Organisationskomitee für Los Angeles 2028 gerade: „Fuck.“
27. Juli 2024, Berlin
Meine Frau und ich gehen bei den Olympischen Spielen all in und sitzen ab 10 Uhr vor dem Fernseher. So wie früher, als wir noch keine Kinder hatten. (Wenn die Kinder groß sind, ist es eigentlich wieder, wie keine zu haben.)
Wir schauen Schwimmen, Schießen, Basketball, Judo, Hockey, Rudern, Kanuslalom, Tischtennis und vieles mehr. Der Turner Lukas Dauser, der sich vor sechs Wochen einen Muskel am Oberarm angerissen hat, legt eine fehlerfreie Übung am Barren hin. Beeindruckend.
Ich habe in der Schule Turnen immer gehasst. Da hieß es für mich nicht, „höher, schneller, weiter“, nicht einmal „Dabeisein ist alles“. Stattdessen versuchte ich immer, mich in der Ecke der Halle rumzudrücken, in der sich der Lehrer gerade nicht aufhielt. Getreu dem unolympischen Motto „Nicht Dabeisein ist alles“.
28. Juli 2024, Berlin
Um nicht den ganzen Tag vor der Glotze zu hocken, gehen meine Frau und ich vormittags spazieren. Schadet ja nicht, sich ein wenig zu bewegen. Um einen Olympia-Cold-Turkey zu vermeiden, schauen wir aber zwischendurch auf dem Handy ein wenig Judo.
###
Marcel und der andere Obdachlose haben schon seit zwei Tagen nicht mehr ihr Lager auf dem Platz vor dem Kloster aufgebaut. Hoffentlich geht es ihnen gut.
Alle Beiträge der Wochenschau finden Sie hier.
Sie möchten informiert werden, damit Sie nie wieder, aber auch wirklich nie wieder einen Familienbetrieb-Beitrag verpassen?


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
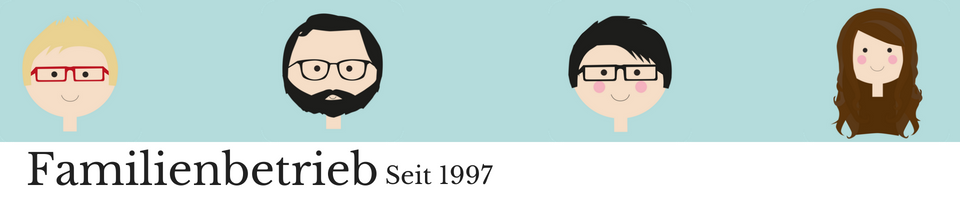
Hi Christian,
“eine queere Modenschau ist da Vincis letztem Abendmahl nachempfunden”
Hattest Du die Assoziation zum Abendmahl bereits beim Anschauen, oder erst nachdem Du die Reaktionen beleidigter Christen im Internet gesehen hast?
Ich bin von dieser Interpretation nämlich ziemlich überrascht und frage mich, ob ich wohl im entscheidenden Moment Popcorn-Nachschub holen war, oder ob das ein genüßlich ausgeschlachteter Strohmann ist.
Die Abendmahl-Assoziation hatte ich nicht sofort. (Bei mindestens der Hälfte der Show wusste ich nicht, was da gerade passiert, war aber trotzdem beeindruckt.) Ich habe es aber so verstanden, dass die Abendmahl-Anlehnung durchaus gewollt war und Offenheit, Inklusion und Toleranz demonstrieren sollte.
Das ist wirklich eine interessante Fallstudie darüber, wie Kommunikation funktioniert. Laut künstlerischem Leiter war das als Bacchanalien gedacht, steht wohl auch so im Programm und passt natürlich auch viel besser zu Olympischen Spielen als eine Abendmahl-Parodie es getan hätte. Aber ein Großteil der Presse hat die Interpretation der Kritiker unhinterfragt übernommen, diskutiert wurde nur noch “darf man das”, nicht mehr “war das überhaupt so”. Was bei konservativen Publikum hängen bleibt ist ein “denen ist auch gar nichts heilig”, dabei waren Christen überhaupt nicht gemeint.