Es ist fast halb zehn, als ich erwache. Beach Body ist nicht da, das heißt, er hält sich an die sonntägliche Regeneration. Ich freue mich auf einen Tag, an dem wir entspannen und am Strand faulenzen können. Nach unserer gestrigen Stadtbummel-Fahrradtour-Minigolf-Action ist das ja auch angebracht.
Ich mache mich fertig und will zum Bäcker gehen. Vorher frage ich den Sohn, ob er mitkommt. Er will nicht. „Und was ist mit dem Gratis-Minibrötchen?“, will ich von ihm wissen. Das sei ihm egal, erwidert er. Er bekomme seine Brötchen ja auch so gratis und die seien viel größer. Damit hat der Sohn zwar recht, bringt mich aber auch auf die Idee, am Frühstückstisch künftig Geld für die Brötchen zu verlangen.
Da heute Sonntag ist, gibt es keine Camping-Wecken beim Bäcker, wie wir letztes Wochenende schmerzhaft lernen mussten. Aber ich bin darauf vorbereitet. In einer Art Selbstsuggestion murmle ich vor mich hin: „Ein Frühstück ohne Camping-Wecken ist möglich, wenn auch sinnlos. Ein Frühstück ohne Camping-Wecken ist möglich, wenn auch sinnlos. Ein Frühstück ohne Camping-Wecken ist möglich, wenn auch sinnlos.“
Im Laden halte ich es dann mit Marie Antoinette und kaufe getreu dem Motto „Wenn das Volk keine Camping-Wecken hat, soll es halt Franzbrötchen essen.“ von dem mit Zucker und Zimt gefüllten Hefegebäck.
Beim Frühstück stellt sich heraus, dass die Franzbrötchen ebenfalls sehr, sehr köstlich sind, auch wenn sie nicht ganz an die Camping-Wecken heranreichen. Aber sich darüber zu grämen, ist wie sich zu beschweren, dass beim Essen das goldene Löffelchen im Hals kratzt.
###
Nach dem Frühstück gehen wir an den Strand. Das Wetter ist zwar etwas bewölkt und nicht ganz so einladend, aber wir setzen uns trotzdem in den Strandkorb. Denn wenn man für etwas bezahlt hat, dann muss man es auch benutzen. Da sind wir ganz deutsch. Gut, nach dieser Logik müssten wir mit den Leihrädern, die wir für die ganze Woche gemietet haben, den Strand hoch und runter fahren, aber so deutsch sind wir doch wieder nicht.
Ich mache es mir im Strandkorb gemütlich, freue mich über den faulen Tag, der vor mir liegt, und schlage mein Buch auf. Plötzlich steht Beach Body vor mir, ruft „Hallöchen!“ und lacht mich strahlend an.
„Was machst du denn hier?“, frage ich ihn und will die Antwort gar nicht wissen.
„Ich habe eine Überraschung für dich“, erklärt Beach enthusiastisch. „Heute findet der Wyker Stadtlauf statt und rate, wer da heute mitläuft?“
Ich hoffe, die Antwort lautet „Die Avengers!“, denn das wäre wirklich eine tolle Überraschung, glaube aber selbst nicht daran. Ich zucke mit den Schultern.
„Du!“, ruft Beach und klatscht in die Hände. „Das ist doch toll, oder?“
Beach und ich haben offensichtlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was „toll“ ist. Toll ist es, den ganzen Tag am Strand zu entspannen. Toll ist es, zwischendurch ein Eis zu essen. Toll ist es, im Strandkorb zu lesen. Toll ist es, sich später noch eine Waffel einzuverleiben. Toll ist es, mit den Kindern am Strand Ball zu spielen. Und toll ist es, sich abends über die restliche Pizza vom Vorabend herzumachen. Nicht toll ist es, Sonntags an einem Volkslauf teilzunehmen.
„Warum?“, frage ich matt.
„Damit nehmen wir mal eine kleine Leistungsüberprüfung vor“, erwidert Beach. „Schauen, ob das Training schon anschlägt.“
Der Wyker Stadtlauf fände dieses Jahr zum 20. Mal statt, erklärt mir Beach, und führe auf einem Rundkurs durch den Ort. Es gäbe einen 10-Kilometer-Hauptlauf sowie einen 5-Kilometer-Jedermannlauf. Das Event würde von ganz vielen Ehrenamtlichen und Freiwilligen sowie mit Unterstützung von Polizei, Feuerwehr und DLRG auf die Beine gestellt. Dieses Engagement sei aller Ehren wert. „Und du wirst diesen Einsatz ganz besonders würdigen, indem du an dem Lauf teilnimmst“, sagt Beach. „Und du wirst dein Bestes geben. Alles andere tritt den Einsatz der Organisatoren mit Füßen“, bläut Beach mir ein.
Ich ziehe resigniert die Laufklamotten an, die Beach mir mitgebracht hat. Er war so gnädig und hat mich für den Jedermannlauf angemeldet, so dass ich nur fünf Kilometer laufen muss. „Das soll hier ja ein Ansporn für dich sein“, erklärt Beach mit ernster Miene. „Würdest du hier mit diesen ganzen durchtrainierten, fitten, gutaussehenden Zehn-Kilometer-Teilnehmern mitlaufen und dich fühlen wie ein ketterauchendes Walross, wäre das ja eher demotivierend für dich.“
Er legt seinen muskulösen Arm um meine Schulter, als würde er mich in den Schwitzkasten nehmen. „Ich bin ja für positive Verstärkung. Deswegen lobe ich dich auch immer, um dich zu motivieren.“ Von diesem pädagogischen Ansatz habe ich in den letzten zwei Wochen zwar nichts mitbekommen, aber ich nicke trotzdem.
###
Beach geht mit mir zum Startbereich auf der Höhe des Musikpavillons, wo normalerweise die Kur-Kapelle für die Föhr-Touristen aufspielt. In fünf Minuten geht der Jedermann-Lauf los. Insgesamt gibt es rund 340 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch die Frau und der Sohn. Um mich herum stehen ziemlich viele durchtrainierte, hagere Menschen, die aussehen, als absolvierten sie schon vor dem Frühstück einen Marathon für einen aktiven Start in den Tag.
Beach massiert mir unterdessen die Schultern, was laut seiner Aussage die Muskulatur lockern soll, aber eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit ist. So müssen sich die rohen Kartoffeln gefühlt haben, die von Raimund Harmstorf in seiner Rolle als ‚Seewolf‘ zerquetscht wurden.
„Konzentrier dich nur auf dich und lauf in deinem eigenen Tempo“, raunt mir Beach ins Ohr. „Okay, vielleicht nicht ganz so langsam wie üblich, denn sonst ist das ein wenig unangenehm für mich als dein Personal Trainer. Die denken dann alle, ich hätte nichts drauf. Die wissen ja nicht, in welchem desolaten Zustand ich dich übernommen habe.“ Er knetet weiter an meinen Schultern rum. „Was ich sagen will: Gib dein Allerbestes. Nichts anderes erwarte ich von dir.“
Ich erwidere darauf nichts, sondern hoffe nur, dass Beach endlich aufhört, meine Schlüsselbeine zu malträtieren.
„Für den Lauf habe ich dir eine extra Playlist aufs Handy gespielt“, erklärt Beach. „Mit den besten Songs für ein flottes Renntempo. Da fliegst du nur so durch das Städtchen.“ Mit diesen Worten drückt er mir meine Kopfhörer in die Hand. „Die Liste ist von mir persönlich kuratiert. Kostet bei den bekannten Streaming-Diensten 39,99 Euro. Das Geld kannst du mir einfach morgen geben.“
Gerade als ich Beach erklären will, dass ich kein Interesse an seiner 39,99-Euro-Lauf-Playlist habe, haut der Wyker Bürgermeister das Startbrett zusammen, und es geht los. Alle Läuferinnen und Läufer in meiner Umgebung rasen sofort in einem Affenzahn los, als sei der Teufel hinter ihnen her. Vielleicht wollen sie aber auch nur schnellstmöglich Abstand zu dem merkwürdigen Zausel mit dem ungepflegten Bart bekommen.
Aus den ersten Startreihen laufen auch viele Kinder los, die meisten im Alter des Sohnes oder etwas jünger. Sie gehen das Rennen viel zu schnell an, wie bei einem Vierhundertmeter-Lauf, weil sie noch nicht in der Lage sind, ihre Kräfte bei einer längeren Distanz einzuschätzen. Nun, die werde ich dann im Verlauf des Rennens eins nach dem anderen einkassieren. Aber ich darf mich jetzt dadurch nicht verrückt machen lassen, sondern muss, wie Beach es mir aufgetragen hat, mein eigenes Tempo laufen.
Auf den ersten Metern komme ich aber ohnehin kaum voran, denn viel zu viele Läuferinnen und Läufer tummeln sich auf viel zu wenig Platz. Es geht erstmal den Sandwall Richtung Hafen entlang, wo die Menschen, die in den Bistros und Cafés sitzen, klatschen und jubeln. Und Kuchen, Waffeln und Eis essen. Das war eigentlich auch mein Tagesziel.
Nach ungefähr 200 Metern biegt das Feld in die Einkaufsstraße ein, in der auch unsere Ferienwohnung liegt. Beach brüllt mir ins Ohr: „Du musst mal ein bisschen überholen, wir sind hier schließlich nicht mehr beim Schaufensterbummeln.“
Die Lauf-Playlist von Beach shuffelt mir derweil die Beastie Boys mit „You must fight for your right to party” ins Ohr. Möglicherweise eine subtile Botschaft, dass ich mich auch mal gegen Beach und seinen Fitness-Terror zur Wehr setzen sollte. „You must fight for your right to Camping-Wecken“. Das hätte bestimmt Nummer-1-Potenzial.
Der erste Kilometer ist geschafft und ich überhole zwei der Kinder vom Start. Wir biegen in ein kurzes Waldstück ein. Survivor singen dazu „Eye of the tiger“. Was für ein Unsinn. Was nutzen mir Tigeraugen, wenn ich hier durch Wyk renne? Da würde „Legs of the gazelle“ viel mehr Sinn machen.
Beach reißt mich aus den Gedanken. „Du musst jetzt langsam mal in den Lauf-Flow kommen“, ruft er mir zu. Das Einzige, was bei mir fließt, ist der Schweiß. Und zwar, wie immer, in meine Augen. Das brennt unglaublich. Als hätte ich gerade eine Chili-Schote geschnitten und mir dann im Gesicht rumgetatscht. Trotzdem gelingt es mir, ein paar weitere Kinder hinter mir zu lassen.
„Es gibt nur deinen Geist und die Laufstrecke!“, fabuliert Beach weiter. Und meine wie die Hölle brennenden Augen, die gibt es leider auch.
Wir passieren die Zwei-Kilometer-Markierung. Quälend langsam ziehe ich an ein paar weiteren Kindern vorbei. Kim Wilde singt dazu „Kids in America“. Jetzt läuft von den Kindern vor mir nur noch ein blonder Junge von circa zwölf Jahren, den ich überholen muss, und dann hat sich dieses Kinderthema erledigt.
„Nimm den Rhythmus auf und halte das Tempo“, blökt Beach mich an. Mir will das mit dem Tempohalten aber nicht so recht gelingen. Wir laufen parallel zum Südstrand. Beach trabt locker neben mir her und klatscht anfeuernd in seine Hände. „Jetzt mal ein bisschen schneller, das ist hier doch kein Schneckenrennen!“ Das muss dieses Loben sein, von dem er am Start gesprochen hat.
Inzwischen sind wir auf die Strandpromenade eingebogen und haben drei Kilometer hinter uns gebracht. Ich platsche wie ein adipöser Elefant über den asphaltierten Weg. Der Abstand zu dem blonden Jungen hält sich hartnäckig. Der Knabe sieht auch noch erstaunlich frisch aus. Also, sofern ich das mit meinen tränenden Augen und aus der Distanz beurteilen kann. Ich spüre, wie meine Oberschenkel allmählich übersäuern.
Die Playlist spielt „Lose yourself“ von Eminem. Ich würde mich jetzt auch gerne verlieren und zwar in einem der netten Cafés in einem der malerischen Inseldörfer, wo ich Friesentorte essen und Kaffee trinken könnte. Das wäre schön.
Nicht schön ist, dass wir gerade bei Kilometer Vier an den Reckstangen vorbeilaufen, an denen mich Beach immer zum Frühsport zwingt. „Denk daran, morgen trainieren wir hier wieder“, ruft Beach mir zu. „Das gibt dir Energie für den Rest der Strecke.“ Ich würde gerne weinen, aber mir fehlt dazu die Kraft. Vielleicht lasse ich mich einfach die Promenade runter auf den Strand fallen und bleibe dort liegen, bis mir die Kinder morgen einen Camping-Wecken vorbeibringen.
Beach hat aber andere Pläne mit mir. „Denk‘ nicht andauernd an diese verzuckerten Hefeklöpse“, knurrt er. „Leg lieber mal einen Zahn zu. Oder sind die alle in den Camping-Wecken steckengeblieben, die du hier gefuttert hast?“
Meine Lunge rasselt inzwischen so laut, dass ich kaum noch die Musik über meine Kopfhörer erkenne. Ich glaube, es ist „Fire Water Burn“ und das beschreibt meine Situation ganz gut. Meine Oberschenkel brennen, meine Waden brennen, meine Sehnen brennen, meine Füße brennen, meine Zehen brennen. Die Bloodhouse Gang singt:
„We don’t need no water,
let the motherfucker burn,
burn, motherfucker,
burn.”
In der Ferne erkenne ich schemenhaft den Musikpavillon, wo das Ziel ist. Noch ungefähr 200 Meter. Und knapp 25 Meter vor mir läuft der blonde Junge. Jetzt wird es Zeit für den Schlussspurt. Damit ich den Blondling noch überhole. Oder ihn wenigsten kurz vor dem Ziel weggrätsche. Das wird ihm dann eine Lehre sein, am Start zu schnell loszulaufen. Ich mobilisiere meine letzten Reserven und erhöhe das Tempo.
Allerdings denkt der Junge anscheinend auch gerade, jetzt wird es Zeit für den Schlussspurt. Sonst läuft mich dieser zauselige Penner von hinten um, der sieht nämlich aus, als sei er nicht mehr zurechnungsfähig. Der Knabe erhöht ebenfalls das Tempo und überquert unter dem frenetischen Jubel der Zuschauerinnen und Zuschauer die Ziellinie.
Mit letzter Kraft taumle ich selbst ins Ziel und breche zusammen. Der Junge kommt zu mir geeilt – aus der Nähe sieht er eher aus wie zehn – und fragt: „Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Soll ich Ihnen etwas zu trinken holen? Sie schauen gar nicht gut aus?“

Da kommt Beach, wirft mich über seine Schulter und trägt mich wie einen Mehlsack zum Ferien-Appartement, wo er mich vor der Tür ablegt. Dann kontrolliert er am Handy die Laufergebnisse, die auf der Stadtlauf-Website in Echtzeit abzulesen sind.
„Aha, zweiter Platz in deiner Altersklasse.“ Beach zieht missbilligend die Augenbrauen zusammen. „Da habe ich mir eigentlich mehr erhofft.“
„Warum?“, krächze ich. „Zweiter ist doch ein Topp-Ergebnis.“
„Für einen Camping-Wecken auf Beinen vielleicht“, erwidert Beach missmutig. „Aber du darfst dich nicht mit so wenig zufriedengeben. Du weißt doch: Der Zweite ist immer der erste Verlierer.“ Er schüttelt unzufrieden den Kopf. „Da müssen wir wohl in der letzten Woche hier auf Föhr noch eine ordentliche Schippe beim Training drauflegen.“
Ich wimmere leise.
„Bis morgen dann zur Fitnesseinheit“, verabschiedet sich Beach.
Ich wimmere laut.
Etwas später erscheinen auch der Sohn und die Frau wieder im Ferien-Appartement. Sie sind beide hochzufrieden mit ihren Zeiten und etwas verwundert, warum ich wie ein alter Lappen auf dem Schlafsofa kauere. Den Rest des Tages verbringen wir dann doch noch ganz relaxt im Strandkorb. Zu mehr wäre ich auch gar nicht in der Lage.
###
Zum Abendbrot gibt es klassisches Resteessen. Sie wissen schon, die übriggebliebene Pizza vom Vorabend sowie einiges an Obst, das vor ein paar Tagen enthusiastisch eingekauft und seitdem mit Ignoranz bis kurz vor dem Gärprozess gestraft wurde.
Weil wir alle kaputt von den Aktivitäten des Tages sind, gehen wir nicht mehr an den Strandkorb, sondern lassen den Tag in der Wohnung ausklingen. Natürlich mit Kniffeln. Es werden insgesamt fünf Kniffel geworfen (vier richtige sowie ein Kniffel der Herzen). Alle von der Tochter, die damit zum vierten Mal in diesem Urlaub den Tagessieg erringt und entsprechend ihre Gesamtführung ausbaut. (Aber immer noch nicht vierstellig.)
Zum Abschluss erzählt jede/r, was am heutigen Tag das Beste war:
- Sohn: Der Stadtlauf
- Tochter: Wie Papa dem Bruder am Strand den Ball an den Kopf geworfen hat
- Frau: Die gute Zeit beim Stadtlauf
- Ich: Dass die Tochter morgen mit zum Schafescheren gehen will
Gute Nacht!
###
Alle Teile des Föhr-Tagebuchs finden Sie hier.

Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
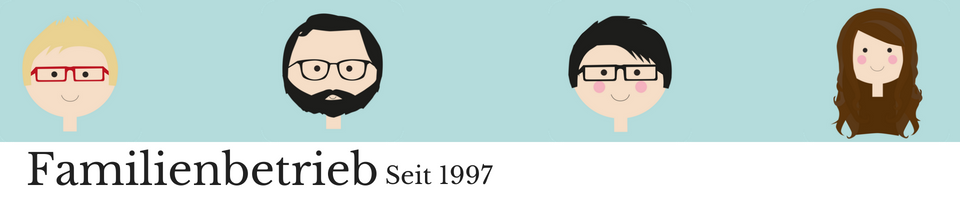
Also ich hätte “Beach Body” schon längst mit Campingwecken vergiftet und in der See versenkt. Mit Trainigsgewichten an den Füßen!!
Die Camping-Wecken könnten als Fußgewichte dienen. Wobei sie dazu eigentlich viel zu lecker sind.
so schön! Selbstironie ist Klasse. Und 21:44? Da wäre ich vermutlich erst bei km 3 angekommen. Oder vorher im Straßengraben krepiert.
Kleiner Tipp fürs Kniffeln. Man kann das aufbohren und DREI Spalten machen. Die erste ist die normale Kniffelspalte, genannt “Kür”. Die 2. ist die “PFLICHT”-Spalte. Da müssen die Felder strikt von oben nach unten gefüllt werden. Die 3. ist die “Hand” – Spalte für alle Würfe “aus der Hand”, also im ersten Versuch. Dafür zählen dort die Punkte doppelt.
Viel Spaß!
Die Kniffel-Varianten haben wir auch schon mal im Urlaub gespielt. Zusätzlich auch noch, dass einer anfängt und die anderen dann die gleiche Kategorie nachwerfen müssen. Danach beginnt dann der nächste Spieler und immer so weiter.
Oh nee, also die Kategorie “Senioren” ist ja echt deprimierend. Ich wäre glatt im Steigleder eingekehrt und hätte mir einige unschöne Dinge gedacht. 🤭
Man muss den Tatsachen in die Augen schauen. Was noch mehr dafür spricht ins Steigleder einzukehren. Da trifft man dann noch ein paar Senioren mehr.