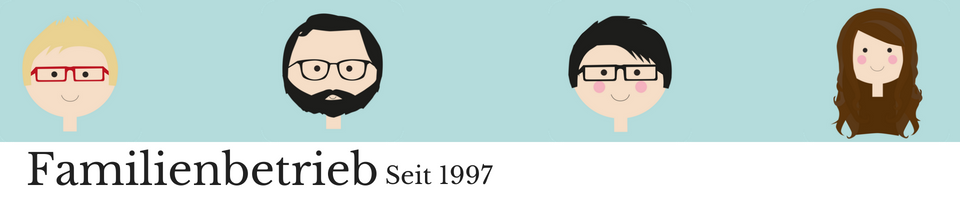Im Anschluss an die Tour schlendern wir durch den Stadtteil El Raval, durch eine enge Gasse, die links und rechts von kleinen Geschäften und Shops gesäumt ist, manche trashig, manche hochwertig.
Normalerweise bin ich gegen das Werben von Straßenhändlern immun. Ich laufe mit mittelmäßig freundlichem Gesicht an ihnen vorbei und sage mittelmäßig freundlich „No, thank you“, ohne richtig darauf zu hören, was sie zu mir sagen.
Nicht weil ich per se ein unhöflicher Mensch bin. Eher im Gegenteil. Das ist Selbstschutz. Bin ich erstmal in ein Gespräch verwickelt worden, gibt es für mich so gut wie keine Möglichkeit, was auch immer mir angeboten wird, nicht zu kaufen. Schließlich möchte ich die Person nicht kränken. (Beweisstück A: Eine WWF-Fördermitgliedschaft, die ich während des Zivildiensts an der Tür meines Schwesternwohnheim-Zimmers abschloss und erst fünfzehn Jahre später kündigte.)
Heute erwischt mich allerdings ein junger Mann auf dem falschen Fuß. Auf sein „Hello, Sir, how are you?“ versagt mein reflexartiges „No, thank you“. Stattdessen erwidere ich: „Pardon?“ (Warum, Christian, warum?)
Daraufhin lässt er ein paar Small-Talk-Floskeln los, um dann festzustellen, meine Brille sei schmutzig. Das ist einerseits etwas distanzlos, fast schon unverschämt, andererseits aber auch zutreffend. Meine Brille ist tatsächlich schmutzig. Eigentlich immer.
Wenig überraschend hat der Verkäufer eine Lösung für mein Schmutzige-Brille-Problem: ein Putzmittel auf Aloe-Vera-Basis, das durch irgendeine Weltraumtechnologie dafür sorgt, dass die Brille nach der Reinigung tagelang nicht von neuem Schmutz behelligt wird. Das demonstriert er an meiner Brille und weil er schon dabei ist, auch an der meiner Frau.
Für ein überschaubar großes Fläschchen des Wundermittels, circa 200 Milliliter, ruft er einen Preis von 25 Euro auf. Weil ich dazu nichts sage, geht er auf 20 Euro runter. Allerdings ist mir das auch zu teuer. Mein Schweigen ist keine Verhandlungstaktik, sondern ich würde das Putzmittel nicht einmal für fünf Euro kaufen.
Ich nehme all meine Kraft zusammen, die mir als People Pleaser zur Verfügung steht, und erkläre, wir hätten kein Interesse. Der junge Mann sagt, dass sei kein Problem, falls wir es uns anders überlegten, könnten wir ja wieder kommen. Im beiderseitigen Wissen, dass das nicht passieren wird, verabschieden wir uns und gehen weiter.
Mir tut das etwas leid. Hätte ich sofort „No, thank you“ gesagt, hätte ich ihm – und uns – Zeit gespart. Allerdings hätte ich dann nicht tagelang eine saubere Brille.
###
Um etwas zu entspannen, suchen wir die Jardins de Rubio i Lurch auf, einen Stadtpark in einem historischen Krankenhaus, der von Mit Vergnügen als „unerwartete Oase“ angepriesen wurde. Dort könne man eine „Pause vom Trubel der Stadt“ einlegen, unter blühenden Orangenbäumen lesen oder Schach mit katalanischen Opas spielen. Das hört sich gut an. (Außer das mit den Schach spielenden katalanischen Opas. Auf die könnte ich verzichten. Nicht weil sie Opas sind und aus Katalonien stammen, sondern wegen des Schachspielens.)
Als wir den Park erreichen, entpuppt er sich als weit weniger idyllisch als bei Mit Vergnügen beschrieben. Eher als Sammel- und Schlafplatz von Obdachlosen und Drogenabhängigen, was nicht unbedingt meinem Verständnis von „unerwarteter Oase” entspricht. (Wobei, unerwartet war es auf seine Weise schon.)
Also legen wir unsere Rast stattdessen am nahegelegenen Playa de Sant Josep ein, einem Platz an einer großen Markthalle mit vielen Lokalen und Bars. Wer dort allerdings auch Rast macht, sind monströs große Möwen. Die machen den Eindruck, als duldeten sie die herumsitzenden Menschen lediglich. Wir beschließen, Ausruhen ist überbewertet und gehen weiter.


Unschönes Erlebnis auf dem Rückweg zum Hotel: In El Born werden wir Zeuge eines Diebstahls. Ein junger Typ versucht einer indischen Touristin die Kette vom Hals zu reißen, was ihm nach kurzem Gerangel gelingt. Meine Frau und ich wollen der Inderin zur Hilfe eilen, aber bis wir kapiert haben, was da gerade passiert, rennt der Dieb schon weg.
Reflexhaft laufe ich ihm ein Stück hinterher, um ihn zu verscheuchen. Dann fällt mir auf, dass er die Kette ja bereits hat und ich ihn folglich einholen müsste, um hier irgendetwas zu bewirken. Was würde aber passieren, wenn ich ihn tatsächlich stelle. Muss ich ihm dann eine reinhauen? Oder macht er das bei mir? Halte das zweite Szenario für wesentlich realistischer und breche die Verfolgung nach wenigen Metern ab.
Ein paar junge Männer kümmern sich derweil um die indische Frau. Wir gehen weiter und halten unsere Rucksäcke und Taschen etwas fester als vorher.
###
Fürs Abendessen hat meine Frau eine weitere Tapas-Bar bei Google ausfindig gemacht. La Pepita kann eine 4,5-Sternebewertung vorweisen und liegt knapp zwei Kilometer von unserem Hotel entfernt im Künstlerviertel Gracia.
Der Stadtteil verströmt leichte Prenzlauer-Berg-Vibes, nur die Leute sehen hier nicht ganz so unangenehm hip aus. Vielleicht kann ich das aber auch nicht so gut beurteilen, weil ich nicht weiß, was in Spanien als hip gilt. (Um ehrlich zu sein, vermag ich das in Deutschland ebenso wenig einzuschätzen.)

Nach kurzer Wartezeit vor der Bar (Stichwort: Freitagabend und keine Reservierung) bringt uns eine junge Frau an der Theke vorbei in den hinteren Teil des Lokals zu unserem Tisch.
Ein junger Mann hinter dem Tresen trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck: „I am not rude I just have the balls to say what everyone else is thinking.“ Ein erstaunliches Statement für jemanden, der in der Gastronomie arbeitet. Gleichermaßen überheblich und unhöflich. Vielleicht ist sein „I am not rude I am just a fucking asshole“-Shirt gerade in der Wäsche.
Bei der Bestellung überfordert mich das Prinzip Tapas ein wenig. Ich möchte fast alles probieren, was auf der Karte steht, weiß aber nicht, wie groß die Portionen sind und wie viele Gerichte du nehmen kannst, bevor die Leute dich für Jumbo Schreiner halten, der versucht, einen Weltrekord im Tapas-Essen aufzustellen.
Wir ordern Chorizo, Käse mit Weintrauben und Rosinen, frittierte Auberginen auf Ziegenfrischkäse mit Apfelraspeln und die wütenden Kartoffeln. So wütend finde ich sie später gar nicht, nur gut gewürzt. Dazu nehmen wir einen halben Liter Sangria und weil man auf einem halben Bein schlecht steht, später noch einen halben.
Als die ersten Speisen auf unserem Tisch stehen, bin ich unsicher, ob ich sofort mit dem Essen anfangen kann oder auf den Rest warten muss oder das gerade nicht tun sollte, weil dann jeder weiß, dass ich ein ignoranter Trottel bin, der hier eigentlich nichts zu suchen hat. (Kulinarischer Luxus-Stress im Urlaub)


Neben uns sitzt ein amerikanisches Paar, etwas älter als wir. Sie bekommen ununterbrochen neue Tellerchen, Schüsselchen und Brettchen mit Leckereien gebracht. Ich glaube, sie haben das Tapas-Game noch weniger verstanden als wir.
Wir kommen mit ihnen ins Gespräch und erfahren, dass sie aus North Carolina sind, er hat deutsche Vorfahren, die er aber nicht kennt. Amerikaner*innen sind so angenehm small-talk erprobt, da fällt selbst mir eine Unterhaltung leicht. Sie wollen nie etwas von dir und freuen sich überschäumend, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland („That’s amazing!“) – sicherlich freuen sie sich genauso, wenn Italiener oder Franzosen erzählen, wo sie herkommen – und nach ein paar Minuten gehen alle fröhlich ihrer Wege.
Damit die beiden sich mit ihrem vielen Essen nicht so schlecht fühlen, bestellen wir noch Nachtisch. Irgendetwas sehr Schokoladiges und Mais-Eis mit Popcorn. Beides köstlich.
Bilanz des Tages
- 10 Kilometer gelaufen
- 34.235 Schritte gegangen
- 0 Brillenputzmittel gekauft
- 0 Überfälle vereitelt
- 1 Liter Sangria getrunken
Alle Beiträge des ¡Hola España!-Blogs finden Sie hier:
- Vorbereitung (03.09.): Zurück in die Vergangenheit
- Anreise (04.09.): Auf Kaffeefahrt mit der Deutschen Bahn
- Barcelona (1) (05.09.): Immer geradeaus
- Barcelona (2) (06.09.): Saubere Brillen und wütende Kartoffeln
- Ankunft (07.09.): Blick aufs Meer (und ein bisschen Parkplatz)
- Tag 01 (08.09.): Lauf, Christian, lauf
- Tag 02 (09.09.): Do you need a good one or a normal one?
- Tag 03 (10.09.): Dem Meer ist alles egal
- Tag 04 (11.09.): Nationalfeiertagsfeierlichkeiten Fehlanzeige
- Tag 05 (12.09.): Vom Winde gemobbt
- Tag 06 (13.09.): Mein Name ist nicht Bond
- Tag 07 (14.09.): Man spricht kein Deutsch
- Tag 08 (15.09.): Das ganze Leben ist ein Fake. (Zumindest auf der Strandpromenade Richtung Salou)
- Tag 09 (16.09.): Ein Hollywood-Blockbuster für einen Käsekuchen
- Tag 10 (17.09.): Der mittelalte weiße Mann und das Meer
- Tag 11 (18.09.): Kein Regen im Nichts
- Tag 12 (19.09.): Helga, die Schreckliche
- Tag 13 (20.09.): Ein nasser Abschied


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)